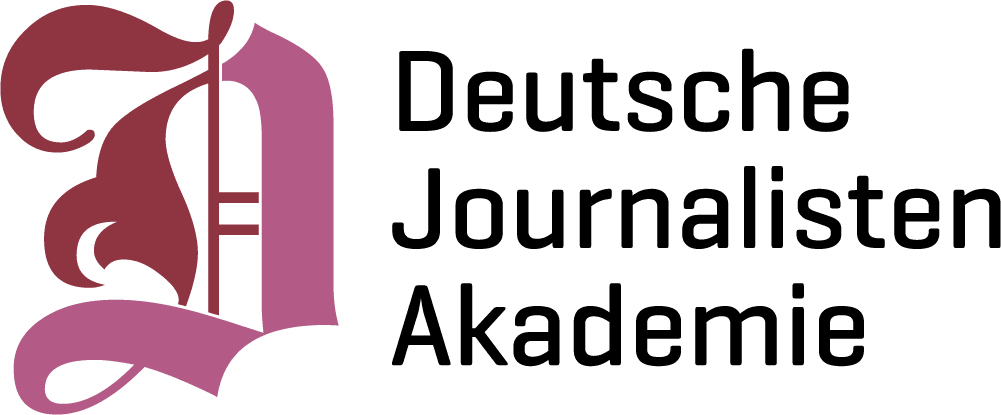Eingebetteter Journalismus
Eingebetteter Journalismus (embedded journalism) bezeichnet die Praxis, Journalisten zur Kriegsberichterstattung militärischen Einheiten zuzuordnen. In der Sprache des Militärs bezieht sich der Begriff auf Medienvertreter, die sich über einen längeren Zeitraum – in der Regel mehrere Monate – bei einer militärischen Einheit aufhalten, im Gegensatz zu einem Aufenthalt von nur einem oder wenigen Tagen. Obwohl der Begriff heute für Journalisten verwendet wird, die sich Einheiten beliebiger Länder anschließen, stammt er ursprünglich aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien, da diese beiden Länder während des Irakkriegs 2003 als erste Journalisten auf diese Weise einsetzten.
Auch wenn Journalisten bereits vor dem Irakkrieg 2003 mit militärischen Einheiten unterwegs waren, geschah dies nie in einem derart organisierten Rahmen und in solch großer Zahl. Dadurch konnten sie direkte und unmittelbare Berichte über Kampfhandlungen liefern, die ungebundenen Journalisten nicht möglich waren. Letztere werden auch als „Unilaterals“ bezeichnet. Seitdem wurden Journalisten auch in anderen Konflikten, insbesondere im Krieg in Afghanistan, eingebettet.
Eingebettete Journalisten, die selbst unbewaffnet sind, fungieren als nicht kämpfende Mitglieder der zugewiesenen Einheiten. Sie leben, reisen und gehen mit den Soldaten gemeinsam in den Einsatz – ähnlich wie klassische Presseoffiziere des Militärs. Eingebetteter Journalismus bezeichnet daher auch eine neue und engere Beziehung zwischen Militär und Medien, die durch enge Kooperation und gegenseitige Anerkennung der jeweiligen Bedürfnisse gekennzeichnet ist. Genauer gesagt, stellt sie die Anerkennung dar, dass das Militär einerseits eine gewisse Kontrolle über die öffentliche Darstellung eines laufenden Krieges behalten muss, während Journalisten andererseits direkten und kontinuierlichen Zugang zu militärischen Aktionen benötigen, um ihre beruflichen Aufgaben erfüllen zu können.
Historische Wurzeln des eingebetteten Journalismus
Die heutige Praxis, Journalisten während Kriegen in militärische Einheiten einzubinden, kann als Reaktion des US-Militärs auf die Beziehung zwischen Militär und Medien seit dem Vietnamkrieg (1955–75) verstanden werden – insbesondere auf die damalige Unfähigkeit des Militärs, journalistische Berichte zu kontrollieren.
Es wird davon ausgegangen, dass die relativ große Freiheit, die Journalisten während des Vietnamkriegs genossen, auf die enge Beziehung zwischen Militär und Medien im Zweiten Weltkrieg (1939–45) zurückzuführen war. Diese Freiheit führte zu unzensierten Berichten, die das Militär und den Krieg insgesamt kritisch betrachteten. Dies wiederum trug sowohl zu Problemen auf dem Schlachtfeld als auch zu wachsendem öffentlichem Widerstand gegen den Krieg bei. Während das Militär versuchte, ein positives Bild des Kriegsverlaufs zu vermitteln, berichteten die Medien umfassend über den gesamten Kriegsverlauf und nutzten den beispiellosen Zugang, um auch drastische Bilder – einschließlich Gräueltaten – zu veröffentlichen, die den offiziellen Darstellungen widersprachen. Das Verhältnis zwischen Militär und Medien verschlechterte sich im Verlauf des Krieges zusehends, insbesondere als der politische Konsens über den Krieg schwand und der Widerstand in der Bevölkerung zunahm. Dies führte dazu, dass das Verteidigungsministerium über Möglichkeiten nachdachte, Journalisten in zukünftigen Kriegen besser kontrollieren zu können.
Während der US-Invasion in Grenada 1983, deren offizieller Zweck der Schutz amerikanischer Leben nach einem linken Umsturz war, durften Journalisten in den ersten 48 Stunden nicht direkt über den Angriff berichten. Dies wurde mit der Gewährleistung der operativen Sicherheit und des persönlichen Schutzes der Journalisten begründet. Nach Ablauf dieser Frist wurden 15 Journalisten unter militärischer Aufsicht auf die Insel gebracht. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kampfhandlungen jedoch bereits beendet.
Dieses Bestreben, journalistischen Zugang zu kontrollieren, wurde während der US-Invasion in Panama 1985 weiter formalisiert. Dort wurde ein sogenannter National Media Pool eingerichtet. Ausgewählte Journalisten erhielten Zugang zur Invasion und mussten ihre Berichte mit anderen Journalisten teilen, die keinen Zugang erhalten hatten. Wie schon 1983 in Grenada bekamen jedoch nur wenige Journalisten Zugang zum Schlachtfeld, bevor die Kämpfe beendet waren. Die meisten mussten während der ersten Stunden der Invasion in Militärbaracken bleiben, wo ihnen ein Vortrag über die Geschichte Panamas gehalten wurde.
Dieses Pool-System wurde während des Irakkriegs 1991 ausgeweitet. Die Vereinigten Staaten und andere Koalitionsstreitkräfte schränkten mithilfe von Akkreditierungen, Pressepools und militärischer Begleitung streng ein, wann, wo und was Journalisten berichten durften. Es wurden Nachrichtensperren verhängt, und das Militär behielt sich das Recht vor, alle Berichte vor ihrer Veröffentlichung zu prüfen und zu zensieren.
Seitdem – insbesondere seit 2003, als das heutige Programm des eingebetteten Journalismus eingeführt wurde – haben Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie es dem Militär zunehmend erschwert, die Informationsverbreitung zu kontrollieren. Daher verfolgte das Verteidigungsministerium 2003 im Irakkrieg einen proaktiveren Ansatz und setzte ein System um, das einen Kompromiss zwischen militärischer Kontrolle und journalistischem Zugang darstellte.
Die Praxis des eingebetteten Journalismus
Wie bereits erwähnt, begann die Einbindung von Journalisten in militärische Einheiten 2003 im Irakkrieg in größerem Maßstab. Vor Beginn der Kampfhandlungen bat das Verteidigungsministerium ausgewählte Medienhäuser, potenzielle Journalisten zu Mini-Bootcamps zu schicken, in denen sie mit dem Militärleben vertraut gemacht und auf die Zusammenarbeit mit den Einheiten vorbereitet wurden. Die Journalisten mussten ein Dokument unterschreiben, in dem sie das Militär von jeder Verantwortung im Falle einer Verletzung freistellten. Außerdem mussten sie zustimmen, dass das Militär ihre Einbindung jederzeit und ohne Angabe von Gründen beenden konnte. Kommandeure durften unter bestimmten Umständen die Nutzung elektronischer Geräte einschränken, sicherten jedoch zu, keine Berichte zu prüfen oder zu zensieren.
Diese Regelungen wurden bereits im Januar 2002 festgelegt, als sich 50 führende Vertreter großer US-Medien mit dem Verteidigungsministerium trafen, um die Grundlagen des eingebetteten Pressesystems festzulegen – offiziell als Coalition Forces Land Component Command Ground Rules Agreement bezeichnet.
Während ihres Einsatzes lebten die eingebetteten Journalisten wie reguläre Mitglieder der ihnen zugewiesenen Einheiten. Das Militär stellte Transport, Unterkunft, Verpflegung und Schutz bereit. Die Journalisten waren somit stark abhängig vom Militär. Sie verfügten über keine eigenen Fahrzeuge oder andere Möglichkeiten, sich unabhängig zu bewegen, und unterlagen verschiedenen Berichterstattungsbeschränkungen – darunter das Verbot, über zukünftige Einsätze, eingesetzte Waffen und insbesondere geografische Positionen zu berichten.
Insgesamt wurden über 900 Journalisten bei amerikanischen und britischen Einheiten eingebettet, darunter bei Luftwaffe, Armee, Marineinfanterie und Marine. Der Großteil dieser Journalisten stammte aus den USA oder Großbritannien, etwa 100 kamen aus anderen Ländern, darunter auch aus dem Nahen Osten, beispielsweise vom Satellitensender Al-Jazeera. Die Journalisten stammten von großen Fernsehsendern (z. B. ABC, CBC, NBC), etablierten Tageszeitungen (z. B. New York Times, Washington Post) und bekannten Magazinen (z. B. People, Rolling Stone).
Nach dem Fall von Bagdad im April 2003 verließen über 700 Journalisten das Programm. Weniger als 200 blieben für den weiteren Verlauf des Krieges eingebettet. Im Gegensatz dazu standen die ungebundenen (unilateralen) Journalisten nicht unter militärischem Schutz und wurden von den Einheiten wie zivile Personen behandelt. Das Einbindungsprogramm fungierte somit auch als eine Art Akkreditierungssystem. Eingebettete Journalisten galten als offiziell anerkannt, während Unilaterale als unerwünschte Personen betrachtet wurden. Selbst innerhalb der eingebetteten Journalisten wurden bevorzugte Einsätze durch das Militär vergeben.
Das Programm verlief jedoch nicht immer reibungslos. So mussten eingebettete Journalisten auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln gegen das Militär kämpfen, um angemessen berichten zu dürfen. Der verantwortliche Marineoffizier zwang sie, strengere Regeln zu akzeptieren als offiziell vorgesehen. So wurde ein Vertreter der Marine jeder Interviewrunde beigeordnet, und Journalisten wurde der Zutritt zur allgemeinen Messe verweigert, was sie vom Kontakt mit Matrosen ausschloss. Erst nachdem sich einige Journalisten bei höheren Stellen beschwert hatten, wurden die Einschränkungen aufgehoben.
Kritik am eingebetteten Journalismus
Trotz seiner zunehmenden Verbreitung seit dem Irakkrieg 2003 bleibt das Konzept umstritten. Wissenschaftler wie auch Journalisten kritisieren, dass eingebettete Reporter dem Militär zu sehr verpflichtet seien und daher dazu neigen, dessen offizielle Sichtweise zu übernehmen, statt unabhängig zu berichten. Studien bestätigen diese Bedenken: Die Berichterstattung eingebetteter Journalisten fällt im Vergleich zu ungebundenen Berichten positiver aus und verwendet häufiger episodische Darstellungsformen (Fokus auf einzelne Ereignisse auf dem Schlachtfeld) statt thematischer Analysen (Einordnung in größere Zusammenhänge).
Allerdings bleibt die Kriegsberichterstattung insgesamt problematisch. Forschungen zeigen, dass sowohl eingebettete als auch ungebundene Journalisten ihre Berichterstattung stark an der Haltung politischer Eliten ausrichten. Das bedeutet: Solange unter den Eliten Konsens über einen Krieg herrscht, ist die Berichterstattung tendenziell positiv. Erst bei wachsender Uneinigkeit unter Entscheidungsträgern wird sie kritischer.
Autor: Prof. Dr. Tanni Haas