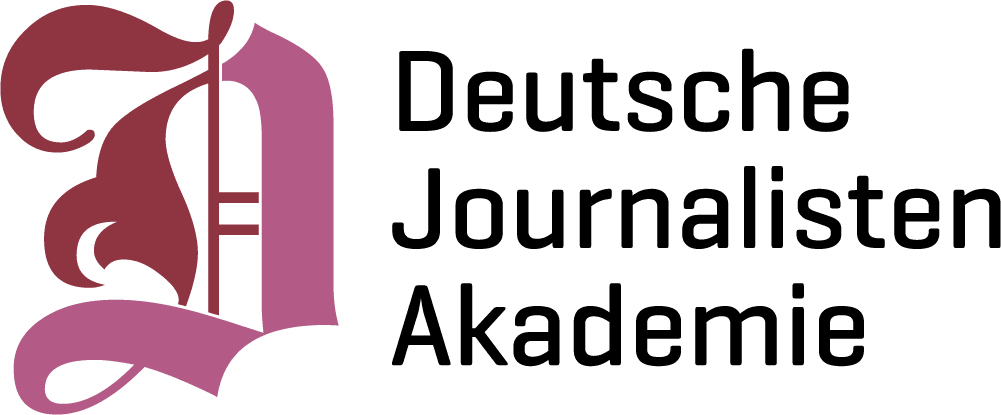Wiki-Journalismus
Digitale Technologien und neue Medienformen haben die Entwicklung des Journalismus als Praxis und öffentliches Gut im Internetzeitalter vorangetrieben, was Produktion, Inhalte und Verbreitung betrifft. Von Nutzern erstellte Inhalte (User-Generated Content, UGC) sind eine treibende Kraft in dieser Entwicklung, die die Natur von Nachrichten sowie das Verhältnis der Medienbranche zu ihrem Publikum – und mit ihm – unwiderruflich verändert hat.
In der Tradition des öffentlichen Journalismus sind funktionierende demokratische Gesellschaften durch eine breite Bürgerbeteiligung an den Prozessen des öffentlichen Lebens gekennzeichnet. Solche Gesellschaften werden durch eine Form des Journalismus gefördert, die die bürgerliche Teilhabe an öffentlichen Angelegenheiten einbezieht. Bis zum Aufkommen des Internets wurde dieser Ansatz des öffentlichen Journalismus von professionellen Journalisten und Redakteuren bestimmt, gefiltert, geformt und produziert, die die klassische Rolle der Torwächter erfüllten, indem sie entschieden, was die Öffentlichkeit wissen sollte. Das Publikum war eine passive Einheit. Im Internetzeitalter jedoch, hat die Technologie die Bürger von passiven Konsumenten professionell produzierter Nachrichten in aktive Teilnehmer verwandelt, die sich ihren eigenen Journalismus aus verschiedenen Elementen selbst zusammenstellen können.
Digitale Technologie erlaubt es Bürgern heute, über mobile Geräte, Blogs, Mikroblogs (wie Twitter), soziale Netzwerke und andere Kanäle eigene persönliche Berichte, Darstellungen und Geschichten zu öffentlichen Themen und Ereignissen ihrer Wahl zu erstellen und zu verbreiten. Medienorganisationen haben nach und nach Crowdsourcing in ihre Informationsbeschaffungsprozesse eingebaut, um nutzergenerierte Inhalte als Mittel zur Verbindung und Zusammenarbeit mit ihrem Publikum zu nutzen.
Wiki-Journalismus existiert aufgrund dieses sich wandelnden Medienumfelds – und er gedeiht. Medienwissenschaftler verorten den Wiki-Journalismus innerhalb eines größeren Rahmens des partizipativen Journalismus, definiert als eine Praxis, bei der Bürger eine aktive Rolle im Prozess der Nachrichtenproduktion spielen. Partizipativer Journalismus hat den Online-Journalismus nicht nur als Bericht oder Veröffentlichung neu gedacht, sondern als Lebenszyklus, in dem Software entwickelt, Nutzer befähigt, journalistische Inhalte erstellt werden – und sich der Prozess wiederholt und verbessert. Wiki-Journalismus erweitert diesen „Lebenszyklus“-Begriff, indem er einen fortlaufenden, iterativen, aktualisierten Bericht über eine Nachrichtengeschichte bietet.
Einige betrachten Wiki-Journalismus als die natürliche Weiterentwicklung partizipativer Journalismusformen. Wenn Blogs es Menschen ermöglichen, zu publizieren und sich auszudrücken, und soziale Netzwerke sie zusammenbringen, dann sind Wikis Plattformen, die es jenen, die sich gefunden haben, ermöglichen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam etwas aufzubauen.
Diese Art von Journalismus wird durch Wiki-Technologie ermöglicht und geprägt: webbasierte, quelloffene, kollaborative Software, die den fortlaufenden, in Echtzeit stattfindenden Informationsfluss zwischen mehreren Nutzern erlaubt und erleichtert, sowie die Veröffentlichung dieser Inhalte im digitalen Gemeinwesen. Sie ist auch durch den Aufstieg des Bürgerjournalismus möglich geworden, bei dem Menschen heute in der Lage sind, Nachrichtenereignisse schneller zu melden, weil sie über Technologie und Werkzeuge zur Informationsgewinnung und -verbreitung verfügen. Wiki-Journalismus gilt als vielversprechende Praxis, weil er traditionelle journalistische Normen herausfordert und gleichzeitig eine neue Form digital-nativer Medieninhalte schafft.
Wenn Bürger befähigt werden, Nachrichteninhalte mitzugestalten und gleichzeitig zu konsumieren, überschreiten sie das traditionelle Gatekeeping-Modell des Journalismus, in dem allein professionelle Journalisten über die Relevanz einer Geschichte oder deren Blickwinkel entschieden. Beiträge von Bürgern zum Nachrichtenjournalismus bringen vielfältige Perspektiven in die Berichterstattung ein, was – wie mehrere Medienwissenschaftler betont haben – helfen kann, die Herausforderungen von Objektivität und Voreingenommenheit im traditionellen Journalismus zu überwinden.
Tatsächlich wurde Wiki-Journalismus im Geist der „Unabhängigkeit des Denkens“ geschaffen und strebt durch die Einbeziehung einer Vielzahl von Meinungen, Perspektiven und Erfahrungen von Mitwirkenden eine „neutrale Sichtweise“ an. Dies wird als Unterschied zur unabhängigen (indy) Medienpraxis oder dem engagierten Journalismus betrachtet, die aktiv eine einseitige Perspektive auf Themen einnehmen.
Das Potenzial des Wiki-Journalismus umfasst:
- Die Fähigkeit, den Grundauftrag des partizipativen oder Bürgerjournalismus zu erweitern.
- Einen digitalen Raum, in dem Bürger kritisches Denken und Berichterstattungsfähigkeiten zu für sie relevanten Themen entwickeln können.
- Kompatibilität mit den Routinen der Informationsbeschaffung und -verbreitung im Mainstream-Journalismus.
- Einen Prozess für Nachrichtenorganisationen, das soziale Potenzial des Internets zu nutzen, um auf neue Weise mit dem Publikum in Kontakt zu treten.
Während mehrere Beispiele für Wiki-Journalismus das Potenzial dieses Ansatzes aufzeigen, gibt es auch verschiedene Bedenken hinsichtlich des Prozesses: die Zuverlässigkeit Wiki-generierter Inhalte, Verifizierungspraktiken, Anfälligkeit für Sabotage, rechtliche Bedenken bezüglich der Veröffentlichung sowie ein häufiges Fehlen der narrativen Struktur, die traditionellen journalistischen Formen eigen ist.
Die Ursprünge des Wiki-Journalismus
Wiki-Journalismus entstand durch das Internet, die Open-Source-Bewegung, digital basierte kollaborative Bearbeitung und offene Veröffentlichung. Um den Prozess des Wiki-Journalismus zu verstehen, ist es wichtig, das Konzept und die Funktionsweise der Wiki-Technologie selbst zu betrachten. Wiki ist ein hawaiianisches Wort für „schnell“ und wurde Mitte der 1990er Jahre von Ward Cunningham, einem der Begründer der Wiki-Software, übernommen. Diese Technologie funktioniert als Internetanwendung und Content-Management-System (CMS) und wird auch als „soziale Software“ bezeichnet, die es mehreren Nutzern und Autoren erlaubt, Inhalte – zum Beispiel Webseiten – über einen gemeinsamen Browser hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen.
„Wikiwebs“ existieren seit Mitte der 1990er Jahre und wurden zunächst für das interne Kommunikationsmanagement von Unternehmen und Organisationen verwendet. Die Technologie gewann im Jahr 2001 mit dem Start von Wikipedia, der inzwischen allgegenwärtigen Online-Enzyklopädie, an Fahrt. Die erste Nachrichtenplattform, die auf Wiki-Technologie basierte, war Wikinews, gegründet 2003 unter dem Dach der Wikimedia Foundation mit dem Ziel, den Bürgerjournalismus zu fördern und weiterzuentwickeln.
Damals betonte der Mitbegründer von Wikinews, dass der Dienst sich ausdrücklich von Wikipedia unterscheiden sollte, da es hier um journalistisch entwickelte Beiträge als Nachrichtengeschichten und nicht um enzyklopädische Einträge ging. Im Gegensatz zu Wikipedia sollte der Wikinews-Prozess originelle Berichterstattung ermöglichen, etwa Augenzeugenberichte und Erfahrungsberichte, die nicht zwingend auf eine Quelle zurückzuführen waren. Von Anfang an bemühte sich Wikinews, zuverlässige, unparteiische und relevante Nachrichten kostenlos im globalen digitalen Gemeingut bereitzustellen. Die Gründer glaubten, dass die Anwendung des Wiki-Prozesses auf die Nachrichtenproduktion einen eigenständigen, neutralen, unabhängigen, durch die Masse getragenen Nachrichtenstrom erzeugen würde, der mit etablierten Medien konkurrieren könne.
Die Berichte und Inhalte bieten eine breite Perspektive, ausgehend von einer Vielzahl von Bürgern und Bewohnern, statt ausschließlich von Amtsträgern und Autoritätspersonen. Das zentrale redaktionelle Prinzip von Wikinews ist ein neutraler Standpunkt (NPOV), erreicht durch die Zusammenstellung unterschiedlichster Perspektiven. Wenn Objektivität im Journalismus bedeutet, eine konsistente Methode zur Überprüfung von Informationen zu entwickeln – um persönliche Voreingenommenheit zu mindern – dann überträgt ein NPOV-Ansatz diese Verantwortung auf den kollektiven Denkprozess. Unparteiischer Journalismus könnte durch Wiki-Technologie besser erreichbar sein, weil Berichte aus vielen verschiedenen Quellen – nicht nur von offiziellen Stellen – gesammelt werden.
Medienwissenschaftler haben auch festgestellt, dass Wiki-Journalismus nicht nur philosophische oder demokratische Alternativen zur Nachrichtenproduktion bietet, sondern auch potenzielle finanzielle und wirtschaftliche Vorteile für Medienorganisationen. Eine Medienorganisation, die eine Wiki-Nachrichtengeschichte hostet, bietet ihrem Publikum die Möglichkeit zur Teilnahme an der Nachrichtenproduktion – und kann damit die Verweildauer der Leser auf der Website erhöhen, was wiederum für Werbekunden relevant ist.
Wiki-Journalismus in der Praxis
Wiki-Journalismus unterscheidet sich von traditionelleren, von Redaktionsschluss geprägten Medienformen, weil Geschichten fortlaufend aufgebaut werden – auch bekannt als „iterativer“ Journalismus. Es wurden verschiedene Formen des Wiki-Journalismus identifiziert, von durch Leser bearbeiteten Inhalten bis hin zu von Lesern generierten Inhalten zu einem bestimmten Thema. Ein treibendes Merkmal ist, dass diese Nachrichtenberichte Ergebnis einer Zusammenarbeit sind – oft zwischen professionellen und „Bürger“-Journalisten – die Informationen, Berichte, Zitate, Fotos und Videos sammeln und diese Inhalte verifizieren, um eine gemeinsame Nachrichtengeschichte zu erstellen.
Wikinews ist die früheste, bekannteste und produktivste Initiative dieses Ansatzes. In mehr als 30 Sprachen veröffentlicht, bekennt sich Wikinews dazu, Inhalte kostenlos bereitzustellen, zu denen jeder eingeladen ist, über große und kleine Ereignisse zu berichten – entweder aus direkter Erfahrung oder in Zusammenfassung anderer Quellen. Das Wikinews-Portal beherbergt zehntausende Geschichten, von Berichten über aktuelle Ereignisse (z. B. die Schießerei an der Virginia Tech oder den Bombenanschlag beim Boston-Marathon) bis hin zu wetterbedingten Krisen. Die Wikinews-Seite zu Hurrikan Katrina ist eines der frühen erfolgreichen Modelle dieser Art der Berichterstattung.
Wikis bieten einen digitalen Prozess und ein Forum, um mehrere Darstellungen von sich entfaltenden Ereignissen in Echtzeit schnell zu sammeln – besonders wertvoll bei Geschichten, die auf Augenzeugenberichten beruhen. Sie bieten auch einen digitalen Raum, in dem sich rasch eine Ad-hoc-Gemeinschaft um ein Nachrichtenthema bilden kann, was einen wichtigen Rahmen für den Informationsaustausch darstellt.
Andere Formen des Wiki-Journalismus waren weniger erfolgreich. Die Los Angeles Times experimentierte 2005 mit dem Wiki-Prozess, um ein „Wikitorial“ zu schaffen – eine Online-Version eines traditionellen Leitartikels, die als Wiki bearbeitet werden konnte. Der erste Times-Wikitorial trug den Titel „Krieg und Konsequenzen“ und behandelte den Irakkrieg. Nutzer waren eingeladen, den Leitartikel zu ergänzen, zu bearbeiten oder neu zu schreiben, um einen durch die Masse verfassten Meinungsbeitrag zu erstellen. Das Experiment war nur von kurzer Dauer. Der Wikitorial wurde rasch mit unangemessenen, pornografischen Inhalten überflutet, woraufhin die Times ihn zwei Tage nach dem Start zurückzog.
Einige Beobachter haben vorgeschlagen, dass etablierte Nachrichtenorganisationen, die einen Wiki-Ansatz verfolgen wollen, den Prozess besser steuern könnten, indem sie einen Moderator, Kurator oder Inhaltsmanager einsetzen, um den Überblick über die Geschichte zu behalten. Dieser Vorschlag selbst stellt allerdings das Konzept des Wiki-Journalismus infrage und zeigt damit einige seiner strukturellen Grenzen auf.
Kritik am Wiki-Journalismus
Die Hauptkritikpunkte am Modell des Wiki-Journalismus sind seine Anfälligkeit für Sabotage, das Fehlen einer disziplinierten Verifizierung, seine Existenz in einer rechtlichen Grauzone sowie Subjektivität und Laienhaftigkeit.
Wegen der offenen Struktur des Wiki-Journalismus können bestimmte Geschichten leicht manipuliert oder mit böswilligen Inhalten überflutet werden (wie im Fall des Wikitorials der LA Times). Wikis sind anfällig für Trolle, Sabotage und Vandalismus. Die Einführung höherer Zugangshürden für Mitwirkende kann solche Probleme zwar verhindern, aber auch das Wachstum der Inhalte selbst einschränken oder verlangsamen.
Während traditioneller Journalismus von Verifikation und Genauigkeit geleitet wird, arbeitet Wiki-Journalismus mit einem System aus Kontrollen und Gegengewichten, das von mehreren Nutzern gesteuert wird. Viele Beobachter haben festgestellt, dass dies Fehler begünstigt. Wiki-Mitwirkende fügen oft Inhalte hinzu, die sie aus anderen Medienquellen sehen, hören oder lesen – selbst in Situationen aktueller Berichterstattung. Während Augenzeugenberichte und UGC wertvolle, erfahrungsbasierte Inhalte liefern können, sind überarbeitete Inhalte nicht zwangsläufig unabhängig verifiziert.
Dies wirft rechtliche Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf kontroverse oder potenziell verleumderische Aussagen, die in Wikis veröffentlicht werden. Nach geltendem Verlagsrecht in den meisten Ländern sind Medienorganisationen – und nicht die Autoren in ihrem Auftrag – letztlich für die Inhalte verantwortlich, die sie veröffentlichen. Nachrichtenorganisationen, die sich auf Wiki-Veröffentlichungen einlassen, setzen sich damit der unvorhersehbaren Ausgabe einer potenziell unbegrenzten Anzahl von Mitwirkenden aus.
Einige Beobachter haben auch festgestellt, dass Wiki-Modelle des Journalismus möglicherweise nicht denselben Grad an Autorität oder Glaubwürdigkeit besitzen wie traditionelle Nachrichtenquellen, die professionell verfasst sind. Wenn das wahre Prinzip des Journalismus nicht Objektivität ist, sondern – wie es ein Medienwissenschaftler vorgeschlagen hat – ein Ansatz, der auf Gründlichkeit, Genauigkeit, Fairness und Transparenz beruht, dann ist Wiki-Journalismus nur ein Ausgangspunkt im wachsenden Feld des partizipativen Journalismus. Es besteht weiterhin ein Bedarf an Einordnung, professioneller Verarbeitung und Kontextualisierung von Informationen.
Autorin: Corinne Smith